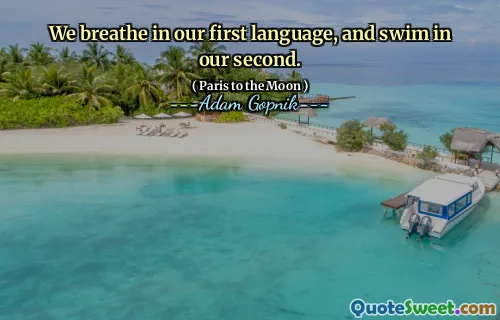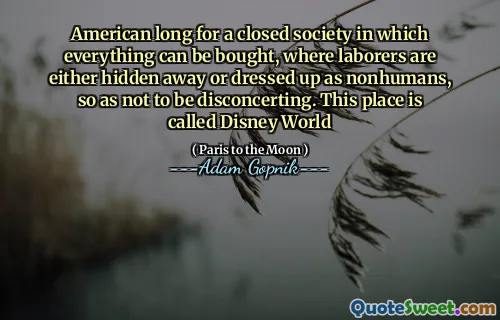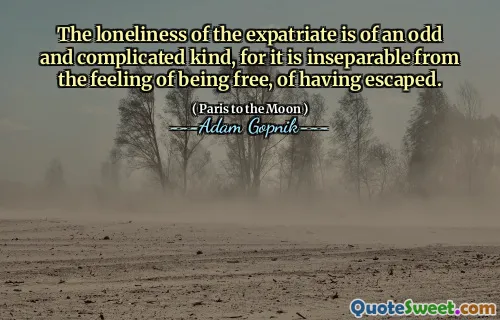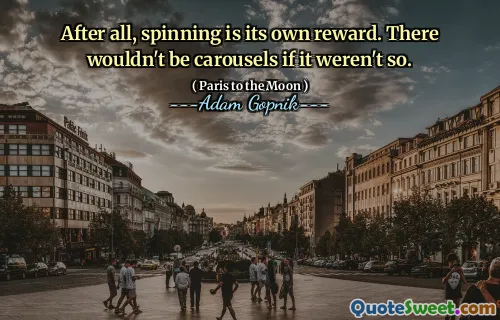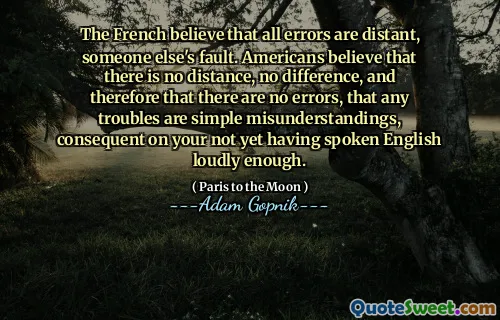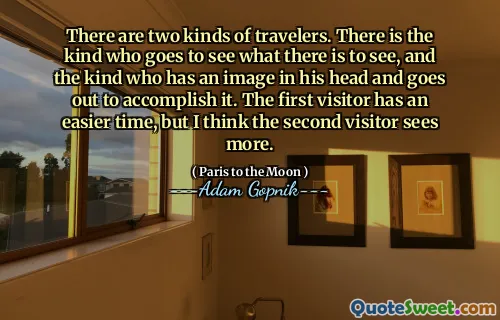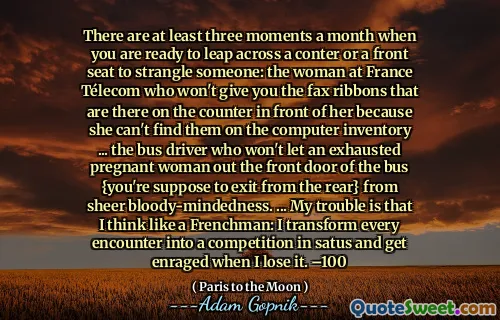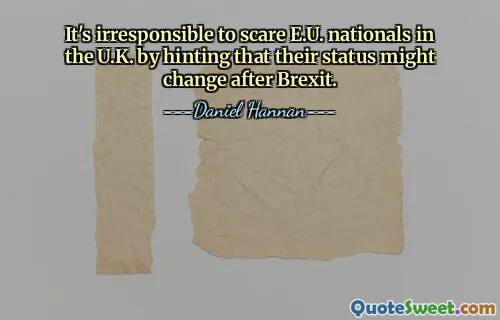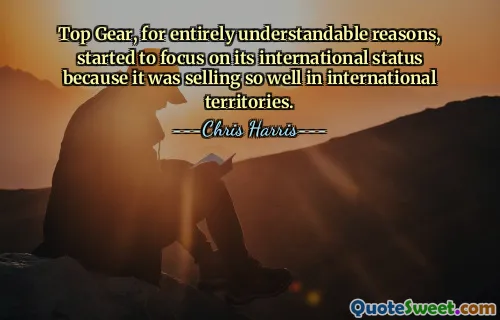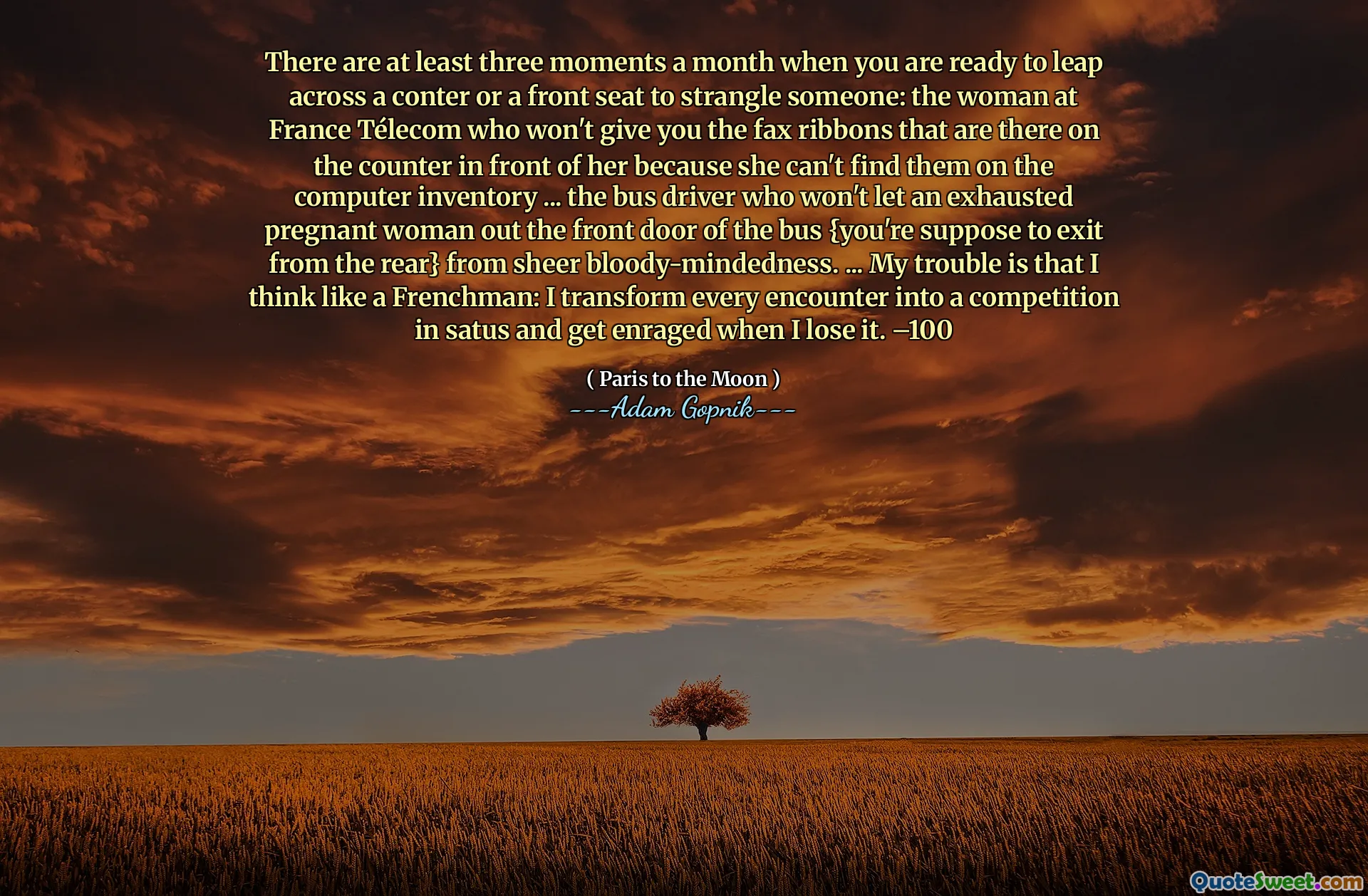
Es gibt mindestens drei Momente im Monat, wenn Sie bereit sind, über einen Conter oder einen Vordersitz zu springen, um jemanden zu erwürgen: die Frau in Frankreich Télecom, die Ihnen nicht die Faxbänder gibt, die vor ihr auf der Theke sind, weil Sie kann sie nicht am Computerinventar finden ... der Busfahrer, der eine erschöpfte schwangere Frau nicht aus der Haustür des Busses aus lassen lässt (Sie sollen von hinten aus verlassen) aus bloßer blutiger Gesinnung. ... Mein Problem ist, dass ich wie ein Franzose denke: Ich verwandle jede Begegnung in einen Wettbewerb im Satus und werde wütend, wenn ich sie verliere. –100
(There are at least three moments a month when you are ready to leap across a conter or a front seat to strangle someone: the woman at France Télecom who won't give you the fax ribbons that are there on the counter in front of her because she can't find them on the computer inventory ... the bus driver who won't let an exhausted pregnant woman out the front door of the bus {you're suppose to exit from the rear} from sheer bloody-mindedness. ... My trouble is that I think like a Frenchman: I transform every encounter into a competition in satus and get enraged when I lose it. –100)
📖 Adam Gopnik
In Adam Gopniks "Paris zu dem Mond" reflektiert er die häufigen Frustrationen, die in alltäglichen Interaktionen, insbesondere in Paris, auftreten. Er teilt Anekdoten über Momente, die einen intensiven Ärger hervorrufen, wie ein nicht hilfreicher Mitarbeiter in Frankreich Télécom oder einen starren Busfahrer. Diese Instanzen unterstreichen ein größeres Thema von Individuen, die sich in weltlichen Situationen machtlos fühlen, was zu einer emotionalen Reaktion führt, die auf Aggressionen rechnen kann.
Gopnik befasst sich auch mit der Art und Weise, wie diese Erfahrungen durch eine kulturelle Denkweise geprägt sind. Er beschreibt seine Tendenz, Interaktionen als wettbewerbsfähig zu betrachten, insbesondere in Bezug auf den sozialen Status, was seine Irritation verschlimmert, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden. Diese Perspektive zeigt die tieferen psychologischen Mechanismen im Spiel und veranschaulicht, wie scheinbar triviale Momente starke Gefühle hervorrufen können, die auf kulturellen Normen und persönlichen Werten beruhen.